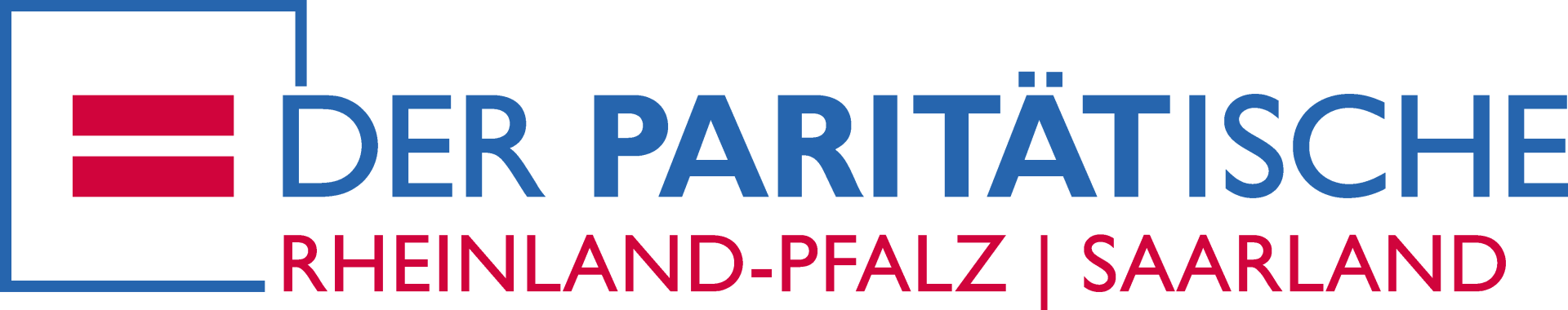8. Pflegebericht der Bundesregierung vorgelegt
Redation • 13. Dezember 2024
Mit Einführung der Pflegeversicherung wurde die Bundesregierung verpflichtet, regelmäßig über die Entwicklung der Pflegeversicherung und den Stand der pflegerischen Versorgung zu berichten. Die Berichte umfassen in der Regel einen Berichtszeitraum von vier Jahren. Der achte Pflegebericht wurde am 13. November 2024 vom Kabinett beschlossen.
Der Bericht umfasst den Zeitraum 2020 bis 2023 und ist in drei Kapitel aufgeteilt:
- Einleitende Zusammenfassung, in der auch die zentralen Ergebnisse des Berichts dargestellt werden.
- Die größten Herausforderungen und Krisen, insbesondere die COVID-19-Pandemie und die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine für die energetische Versorgung der Pflegeeinrichtungen sowie die wichtigsten im Berichtszeitraum angestoßenen und umgesetzten Gesetze, Projekte und Maßnahmen.
- Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zum Stand der pflegerischen Versorgung.
Die zentralen Ergebnisse des Berichts zusammengefasst:
- COVID-19-Pandemie: Die Aufrechterhaltung des Umfangs und der Qualität der pflegerischen Versorgung während der COVID-19-Pandemie gestaltete sich schwierig. Neben fehlenden materiellen Ressourcen wie dem anfänglichen Mangel an persönlicher Schutzausrüstung stellte die COVID-19-Pandemie die Pflegeeinrichtungen auch konzeptionell insbesondere aufgrund von Personalausfällen sowie beim Management von Krankheitsausbrüchen vor große Herausforderungen.
- Pflegeschutzschirm für Pflegeeinrichtungen u. a.: Zugelassene Pflegeeinrichtungen konnten sich mithilfe einer Kostenerstattungsregelung pandemiebedingte Mehrausgaben und Mindereinnahmen aus Mitteln der sozialen Pflegeversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung schnell erstatten lassen. Bis Ende 2023 beliefen sich die Bruttoausgaben der sozialen Pflegeversicherung hierfür insgesamt auf rund 13,2 Milliarden Euro. Zudem wurde die ersatzweise Übernahme der pflegerischen Versorgung von Pflegebedürftigen durch stationäre medizinische Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen ermöglicht. Auch für die nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a SGB XI gab es zur Kompensation der Pandemiefolgen.
- Im Bereich der häuslichen Pflege wurden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um pandemiebedingten Versorgungsengpässen entgegenzuwirken und die Pflegebedürftigen und ihre pflegenden An- und Zugehörigen zu entlasten. Zu nennen sind hier die Möglichkeit der Kostenerstattung in Höhe des ambulanten Sachleistungsbetrags, der flexible Einsatz und die zeitliche Erweiterung der Ansparmöglichkeit des Entlastungsbetrags, der erhöhte Leistungsbetrag für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel, die Ausweitung der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung und des Pflegeunterstützungsgeldes und die Flexibilisierung des Beratungseinsatzes nach § 37 Absatz 3 SGB XI.
- Die COVID-19-Pandemie hat die Stärken, aber v. a. auch die strukturellen Defizite in der Langzeitpflege deutlich gemacht. Hierauf aufbauend müssen Ansatzpunkte für die Förderung der Resilienz des pflegerischen Versorgungssystems definiert werden, mit denen eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung pflegebedürftiger Menschen nachhaltig sichergestellt werden kann.
- Es gilt, eine Verbindung zwischen den Lehren aus der Pandemie und einer verbesserten Krisenresilienz herzustellen. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat hierzu eine strukturierte Aufarbeitung angestoßen, der Lessons-Learned-Prozess wird kontinuierlich weitergeführt.
- Umgang mit weiteren Krisen: Vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. April 2024 wurden den Pflegeeinrichtungen Bundesmittel im Umfang von bis zu zwei Milliarden Euro (davon bis zu 1,5 Milliarden Euro bis Ende 2023) als Ergänzungshilfen zum Ausgleich steigender Preise für leitungsgebundenes Erdgas, leitungsgebundene Wärme und leitungsgebundenen Strom zur Verfügung gestellt. Hiermit wurde sichergestellt, dass die Versorgungssicherheit nicht durch steigende Energiepreise beeinträchtigt wurde und die Pflegebedürftigen nicht mit den energiepreisbedingten Mehrkosten belastet wurden.
- Viele Leistungserbringer widmen sich engagiert dem Thema Nachhaltigkeit, ergreifen selbst Maßnahmen im Umgang mit dem Klimawandel und übernehmen selbst Verantwortung. Dies wird im „Klimapakt Gesundheit“ deutlich. Das BMG begleitet diesen partizipativen Prozess aktiv.
- Hitzeschutz: Neben Extremwetterereignissen wie Hochwasser und Starkniederschlägen stellt insbesondere die Hitze eine Gefahr für die Versorgung Pflegebedürftiger dar. Das BMG hat das Thema mit dem „Hitzeschutzplan für Gesundheit“ aktiv aufgegriffen und gemeinsam mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren unterschiedliche unterstützende Schritte, wie Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen zum Schutz vulnerabler Risikogruppen in der Pflege, eingeleitet. Darüber hinaus hat das BMG den Qualitätsausschuss Pflege gebeten, „Bundeseinheitliche Empfehlungen zum Einsatz von Hitzeschutzplänen in der Pflege“ zu entwickeln. Diese wurden im Mai 2024 vom Qualitätsausschuss Pflege veröffentlicht.
- Zur Vorbereitung auf Katastrophensituationen ist es wichtig, dass Pflegeeinrichtungen Vorkehrungen wie die Bevorratung von Sachmitteln (z. B. Atemschutzmasken für Infektionslagen) und die Etablierung und Einübung von Verfahren (Krisenpläne, Evakuierungspläne) treffen. Der Qualitätsausschuss Pflege wurde dazu verpflichtet, die Maßstäbe und Grundsätze (MuG) für die Pflegequalität in der ambulanten, teil- und vollstationären Pflege sowie in der Kurzzeitpflege um flexible Maßnahmen zur Qualitätssicherung in Krisensituationen zu ergänzen.
- Die insbesondere durch eine über dem demografisch erwartbaren Niveau stärkere Zunahme der Zahl der Pflegebedürftigen – aber auch durch die COVID-19 Pandemie – schwierig gewordene Finanzsituation der sozialen Pflegeversicherung konnte kurzfristig durch die Erhöhung des allgemeinen Beitragssatzes um 0,35 Prozentpunkte, den Bundeszuschuss in den Jahren 2022 und 2023 in Höhe von jeweils einer Milliarde Euro, ein vom Bund gewährtes Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro (Ende 2023 hälftig zurückgezahlt) und die zeitliche Verschiebung der Mittelzuführung an den Pflegevorsorgefonds stabilisiert werden. Während der Corona-Pandemie wurden aus dem Bundeshaushalt zudem erhebliche finanzielle Mittel bereitgestellt, um die Wirtschaft zu stützen bzw. Arbeitsplätze zu erhalten und somit die Einnahmebasis der Pflegeversicherung zu stärken. Zusätzlich wurde die soziale Pflegeversicherung unmittelbar gestützt. So wurden in den Jahren 2020 bis 2022 für „Leistungen des Bundes an den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung für SARS-CoV-2-Pandemie verursachte Belastungen“ 5,5 Milliarden Euro insgesamt ausgezahlt (inkl. Prämien für Beschäftigte in der Langzeitpflege mit 0,5 Milliarden Euro). Weitere 0,5 Milliarden Euro an Prämien gingen an Pflegekräfte in Krankenhäusern. Rund 2,4 Milliarden Euro sind durch die gesetzliche Krankenversicherung sowie die private Pflege-Pflichtversicherung geleistet worden.
- Finanzielle Entlastung und Verbesserung der Leistungen: Seit dem 1. Januar 2022 übernimmt die Pflegeversicherung nach § 43c SGB XI mit einem Leistungszuschlag einen prozentualen Anteil des – nach Berücksichtigung des pflegegradabhängigen Leistungsbetrags noch verbleibenden – pflegebedingten Eigenanteils in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Je nach Verweildauer der pflegebedürftigen Person in der vollstationären Versorgung gibt es gestaffelte Zuschüsse, wodurch die Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen spürbar gemindert und die Leistungsbeziehenden finanziell entlastet werden. Auch in der ambulanten pflegerischen Versorgung und der Kurzzeitpflege konnten mit Wirkung zum 1. Januar 2022 Leistungsverbesserungen umgesetzt werden.
- Mit dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)3 wurden die Zuschläge gemäß § 43c SGB XI zum 1. Januar 2024 nochmals erhöht, außerdem wurden die Beträge für die ambulante Geld- und Sachleistung angehoben, um die häusliche Pflege zu stärken.
- Um die häusliche Pflege weiter zu verbessern, wurde mit dem PUEG ferner die Einführung eines Gemeinsamen Jahresbetrags für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege auf den Weg gebracht, die in zwei Stufen erfolgt. Bereits seit dem 1. Januar 2024 gilt diese wesentliche Verbesserung für junge Schwerstpflegebedürftige der Pflegegrade 4 und 5, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ab dem 1. Juli 2025 wird dann für alle häuslich versorgten Pflegebedürftigen ab dem Pflegegrad 2 der Gemeinsame Jahresbetrag eingeführt, der flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden kann und eine Reihe von Vereinfachungen und Verbesserungen mit sich bringt.
- Mit dem PUEG wurde außerdem ein neuer Leistungsanspruch eingeführt, der es pflegenden An- und Zugehörigen erleichtern soll, eine stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch zu nehmen, wenn die pflegebedürftige Person in dieser Zeit eine vollstationäre Versorgung benötigt. Der neue, eigenständige Anspruch auf Versorgung Pflegebedürftiger während der Zeit, in der ihre Pflegeperson eine stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme in Anspruch nimmt, besteht seit dem 1. Juli 2024 bereits ab Pflegegrad 1.
- Stärkung der kommunalen Pflege: Die Förderung regionaler Netzwerke (nach § 45c Absatz 9 SGB XI) wurde weiter ausgebaut, sodass seit 2022 mehr Fördermittel für längere Förderzeiträume bereitstehen und mehr Netzwerke pro Kreis bzw. kreisfreier Stadt gefördert werden können. Zudem haben die Kommunen ein dauerhaftes Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten zur Beratung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen erhalten. Mit § 123 SGB XI wurde ein neues Förderbudget eingeführt, über das der Spitzenverband Bund der Pflegekassen gemeinsam mit Bundesländern und/oder Kommunen im Zeitraum von 2025 bis 2028 regionalspezifische Modellvorhaben für innovative Unterstützungsmaßnahmen und strukturen für Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und vergleichbar Nahestehende vor Ort und im Quartier fördert.
- Personalgewinnung: Im Berichtszeitraum wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Attraktivität des Pflegeberufs umfassend zu stärken. Die Initiativen reichen von der Aus- und Weiterbildung über ein Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege (Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz – PUEG) vom 19. Juni 2023, BGBl. 2023 I Nr. 155. bessere Bezahlung und die Verbesserung der Personalausstattung bis hin zu weiteren attraktiveren Arbeitsbedingungen im Pflegebereich.
- Die faire und ethische Anwerbung von Pflegefachkräften nach Deutschland wird gefördert durch das vom BMG eingeführte Gütesiegel „Faire Anwerbung Pflege Deutschland“ und die mit dem PUEG geschaffene Möglichkeit, den Aufwand für die Anwerbung von Pflegefachkräften aus dem Ausland in den Vergütungsverhandlungen mit den Kostenträgern zu berücksichtigen. Die Rahmenbedingungen für die Gewinnung von Pflegefachkräften aus dem Ausland wurden weiter verbessert, unter anderem durch den Arbeitsmarktzugang auch für Pflegehilfskräfte, die Ermöglichung von Anerkennungspartnerschaften und Regelungen zur Beschleunigung der Anerkennung der Pflegeausbildung durch die Länderbehörden.
- Eine Stärkung und Modernisierung des Berufsbildes der Pflege erfolgt durch eine Verbesserung der Attraktivität der hochschulischen Pflegeausbildung mit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz (PflStudStG) unter anderem durch die Zahlung einer Ausbildungsvergütung für Studierende.
- Mit der Verpflichtung zur Entlohnung mindestens in Höhe eines Tarifvertrags durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG)5 werden seit dem 1. September 2022 die Tarifabschlüsse in der Pflege zum Maßstab für die Entlohnung aller Pflegeeinrichtungen – auch der nicht tarifgebundenen Pflegeeinrichtungen. Bereits zum Jahresende 2022 stiegen die Löhne gegenüber 2021 in der Pflege deutlich: in der stationären Pflege bei vollzeitbeschäftigten Fachkräften um rund 8 Prozent, bei vollzeitbeschäftigten Hilfskräften sogar um rund 11 Prozent.
- Eine ausreichende Personalausstattung ist ein wesentlicher Baustein für eine gute Qualität der Pflege und zur Bindung des Personals. Mit dieser Zielsetzung wurde für vollstationäre Pflegeeinrichtungen ab dem 1. Juli 2023 ein bundesweit einheitliches Personalbemessungsverfahren gesetzlich eingeführt sowie Anreize für Weiterqualifizierungen und zur Reduzierung von Leiharbeit geschaffen.
- Digitalisierung in der Pflege: Es wurden unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt mit dem Ziel, pflegebedürftigen Menschen in der häuslichen Versorgung digitale Techniken u. a. mit digitalen Pflegehilfsmitteln aus Mitteln der Pflegeversicherung zugänglich zu machen. Ferner wurde die Möglichkeit eröffnet, Beratungen auch per Videokonferenz durchzuführen.
- Der Pflegebereich hat als erste Gruppe der nicht approbierten Gesundheitsberufe die Möglichkeit erhalten, die Telematikinfrastruktur umfassend zu nutzen. Dabei wurde der Pflegebereich bei der Finanzierung weitgehend der Ärzteschaft gleichgestellt.
- Ergebnisse von Forschungs- und Modellprojekten: Seit März 2020 transferiert das vom BMG als bundesweite Plattform geschaffene PND wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis. Mit seinem umfangreichenI nformationsangebot bietet das PND in Zeiten einer häufig diffusen Informationslage fachlich abgesicherte Materialien zu zahlreichen relevanten Pflegethemen.
Quelle: 8. Pflegebericht der Bundesregierung